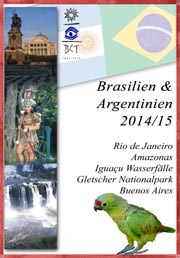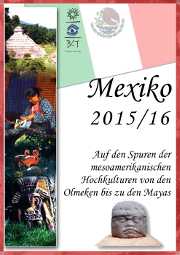Kultur von Caral
Ruinen und Kultur von Caral
Etwa 200 Kilometer nördlich von Lima, der Hauptstadt des heutigen Peru, erstreckt sich auf
einem Wüstenplateau im Supe-Flusstal ein gut 60 Hektar großes Areal, welches Archäologen,
Kunstkenner, Architekten, Völkerkundler und Historiker gleichermaßen verzückt. Hier befinden
sich Überreste einer der ältesten stadtartigen Ansiedlungen – die Ruinen von Caral.
Erstmals erwähnt wurde die Fundstätte 1905 durch den deutschen Forscher Max Uhle. 1940
entstandene Luftaufnahmen zeigten Bilder von kreisrunden Plätzen und Plattformen, doch die
Fachwelt blieb skeptisch. Im unwirtlichen Umfeld der Anden hielt sie zivile Ansiedlungen für
unmöglich. Erst die privat finanzierten Nachforschungen der peruanischen Archäologin Ruth
Martha Shady Solis förderten 2001 Erstaunliches zu Tage: Wie durch Laboruntersuchungen
freigelegter Fundstücke nachgewiesen werden konnte, wurden einzelne Bauwerke der Stadt vor
bereits rund 5000 Jahren errichtet. Die gesamte Anlage erwies sich
als außergewöhnlich gut erhalten und ließ weitere Rückschlüsse auf eine hoch entwickelte
Kultur zu.


Um 3000 vor Christus waren es jedoch zunächst einfache Fischer, die
sich in der Umgebung des Flusses Supe niederließen. Fehlende Großfanggeräte belegen, dass
ihnen ihr Handwerk nicht zu gewerblich betriebenen Überlebenszwecken diente. Vielmehr
nutzten sie das Wasser des Flusses, um ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem anzulegen,
welches die karge Wüstenregion bald in fruchtbare Böden verwandelte. Auf terrassenartig
angelegten Feldern betrieben die ehemaligen Fischer den gezielten Anbau von Kulturpflanzen
wie Getreide, Kürbissen, Hülsenfrüchten und vor allem Baumwolle. Dadurch sicherten sie nicht
nur ihre Selbstversorgung, sondern konnten auch Tauschgeschäfte mit weiter entfernt lebenden
Küsten- und Waldbewohnern betreiben.
Das Design der Stadtanlage Carals beeindruckt auch heute noch durch die meisterhafte
Berücksichtigung bzw. Einbeziehung geometrischer, topografischer und astronomischer Aspekte.
Sie lassen auf entsprechende Kenntnisse und eine genaue Vorausplanung der Erbauer schließen.
Einen weiteren Beweis für deren hoch entwickeltes Wissen tritt der Fund unterschiedlich
langer und kunstvoll verknüpfter Baumwollfäden mit zahlreichen Knoten an: dieses so genannte
Quipu ist Zeugnis einer Schriftsprache, die auf einem mathematischen System basiert und
innerhalb der Andenkultur zur gezielten Speicherung und Weitergabe von Informationen diente.
Die Besiedlung Carals endete um 1600 vor Christus. Erst rund 600
Jahre später wurde die Stadt erneut in Besitz genommen und erlebte in der Epoche zwischen
900 und 1440 eine zweite Blütezeit. Bemerkenswert ist, dass die architektonischen Strukturen
in beiden Siedlungsphasen erhalten geblieben sind. Archäologischen Erkenntnissen zu Folge
haben in und um Caral nie Kriege oder zerstörende Kämpfe stattgefunden; die Stadt weist
keine der üblichen Schutzbauten wie Mauern, Gräben oder Wälle auf. Kontrolle und Macht
müssen über religiöse Mittel erfolgt sein. Die Entdeckung gigantischer Sakralbauten, Tempel
und Pyramiden erhärtet diese Vermutung, macht aber gleichzeitig auf ein weiteres Rätsel
aufmerksam: gleichwohl gut erhaltene Überreste menschlicher Leichen entdeckt wurden, konnte
keine Friedhofsanlage gefunden werden.
Auf Antrag Ruth Martha Shady Solis erklärte die UNESCO Caral 2009 zum Welterbe, da die Stadt
in ihrer Einzigartigkeit eine herausragende Bedeutung für die gesamte Menschheit hat. Mit
ihrer Erforschung konnte nachgewiesen werden, dass die so genannte Neue Welt weitaus früher
von Hochkulturen besiedelt war als bisher angenommen. Auf dieser Einsicht fußend, müsste die
Weltgeschichte umgeschrieben werden. Zu verdanken ist die neue Erkenntnis dem ebenso
skeptischen wie selbstlosen Einsatz der peruanischen Forscherin, die sich im Zuge ihrer
sensationellen Entdeckung auch für die unmittelbare Umgebung Carals stark gemacht hat.